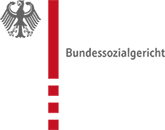Verhandlung B 2 U 32/17 R
Verhandlungstermin
19.06.2018 13:00 Uhr
Terminvorschau
K. S. G. ./. BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe
Die Beteiligten streiten darüber, ob die Klägerin bei einem Unfall, den sie beim Ausladen von Getränkekisten für die Gaststätte ihres Ehemanns erlitt, unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stand. Die Klägerin war im Jahre 2012 mit 35 Stunden pro Woche bei einem Supermarkt beschäftigt, wo sie im Schichtdienst arbeitete. Der Ehemann der Klägerin betreibt eine Gaststätte, an die ein Getränkemarkt angeschlossen ist. Die Klägerin half unter Berücksichtigung ihres Schichtdienstes in der Gaststätte mit, insbesondere bei Großveranstaltungen, ebenso an Wochenenden. Eine bezahlte Anstellung von Hilfskräften erfolgte wegen des geringen Umsatzes zunächst nicht. Einen Arbeitsvertrag schlossen die Ehepartner nicht ab. Am 30.8.2012 besorgte die Klägerin bei ihrem Arbeitgeber auf Bitten ihres Ehemannes Getränke für dessen Gaststätte. Nach der Spätschicht in dem Supermarkt fuhr sie zur Gaststätte und wartete dort das Ende einer Tanzveranstaltung ab. Die Klägerin und ihr Ehemann luden sodann die Getränkekisten aus dem Kleintransporter aus und trugen sie in die Gaststätte. Hierbei wurde die Klägerin gegen 22:40 Uhr von einem anderen Pkw erfasst und gegen den Transporter gequetscht. Die Verletzungen am linken Bein waren so schwer, dass es amputiert werden musste.
Die Beklagte lehnte die Erbringung von Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung ab und wies den Widerspruch der Klägerin zurück. Es handele sich um keine versicherte Wie-Beschäftigung, denn die Tätigkeit sei durch die gegenseitige Hilfsbereitschaft bei Ehegatten geprägt und somit üblich gewesen. Auf die Klage hat das SG die Beklagte unter Aufhebung ihrer Bescheide verurteilt, den Unfall als Arbeitsunfall festzustellen. Die Klägerin sei als sog "Wie-Beschäftigte" iS des § 2 Abs 2 Satz 1 SGB VII tätig geworden. Sie habe trotz ihrer fast vollschichtigen Tätigkeit in nicht unerheblichem Umfang im Betrieb ihres Ehemannes als Hilfskraft ohne Bestehen eines Arbeitsvertrages mitgearbeitet. Die arbeitnehmerähnliche Hilfstätigkeit der Klägerin sei auch über das hinausgegangen, was im Rahmen der ehelichen Gemeinschaft von Ehepartnern untereinander an Unterstützung gefordert werde. Das LSG hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Das Gesamtbild der Tätigkeit der Klägerin im Betrieb ihres Ehemannes stelle sich als arbeitnehmerähnlich dar, wobei nicht isoliert auf die zum Unfall führende Verrichtung abzustellen sei. Die Klägerin habe im gesamten Jahr 2012 bis zu dem eingetretenen Unfall regelmäßig bei den zahlreichen in der Gaststätte stattgefundenen Sonderveranstaltungen ausgeholfen. Hierbei habe sie nach den Angaben ihres Ehemannes die Räume ausgestattet und dekoriert und Speisen vorbereitet sowie im Servicebereich Getränke ausgeschenkt. Sie habe ferner regelmäßig ca zweimal im Monat auf Anweisung ihres Ehemannes Getränke, die bei ihrem Arbeitgeber im Sonderangebot gewesen seien, für die Gaststätte und den Getränkehandel ihres Ehemannes eingekauft und zur Gaststätte transportiert. Ihre Tätigkeiten seien auch konkret unter arbeitnehmerähnlichen Umständen vorgenommen worden. Insoweit habe der Ehemann der Klägerin als Zeuge glaubhaft ausgeführt, dass er seiner Frau bei Veranstaltungen "klare Ansagen" darüber gemacht habe, was sie zu tun habe. Die Klägerin habe auch subjektiv mit der Handlungstendenz gehandelt, arbeitnehmerähnlich tätig zu sein. Die Tätigkeit habe auch nicht durch eine Sonderbeziehung (die Ehe) ihr Gepräge erhalten. Bei Berücksichtigung der gesamten Umstände des Einzelfalles habe es sich um eine geradezu typische Arbeitnehmertätigkeit gehandelt. Diese sei weit über das hinaus gegangen, was im Rahmen einer funktionierenden Ehe von den Ehegatten erwartet werden könne. Auch die Möglichkeit der freiwilligen Versicherung des mitarbeitenden Ehepartners in der gesetzlichen Versicherung gemäß § 6 Abs 1 Satz 1 Nr 1 SGB VII schließe eine "Wie-Beschäftigung" der Klägerin nicht aus.
Die Beklagte rügt mit ihrer Revision eine Verletzung des § 2 Abs 2 Satz 1 SGB VII. Die Tätigkeit der Klägerin sei aufgrund ihrer Handlungstendenz schon nicht arbeitnehmerähnlich, sondern unternehmerähnlich gewesen. Insbesondere die Regelmäßigkeit der Mithilfe spreche gegen die Anwendbarkeit des § 2 Abs 2 SGB VII, denn diese Norm solle von ihrem Regelungszweck her nur vorübergehende Tätigkeiten erfassen und sei gerade nicht auf den Schutz von dauerhafter Mitarbeit ausgelegt.
Sozialgericht Frankfurt (Oder) - S 18 U 164/13
Landessozialgericht Berlin-Brandenburg - L 21 U 85/16
Terminbericht
Die Revision der Beklagten ist nicht begründet. Zu Recht haben die Vorinstanzen entschieden, dass die Klägerin bei der zu dem Unfall führenden Verrichtung als sog "Wie-Beschäftigte" gemäß § 2 Abs 2 Satz 1 SGB VII unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stand. Die Klägerin hat beim Ausladen von Getränkekisten am 30.8.2012 gegen 22:30 Uhr einen Arbeitsunfall iS des § 8 Abs 1 Satz 1 SGB VII erlitten. Bei dieser Verrichtung wurde die Klägerin von außen von einem PKW erfasst und gegen ihren eigenen Transporter gedrückt. Durch dieses plötzliche, von außen kommende Ereignis hat sie ihr Bein verloren und damit auch einen Gesundheitsschaden iS des § 8 Abs 1 SGB VII erlitten. Die Klägerin übte im Zeitpunkt der Verrichtung auch eine versicherte Tätigkeit iS des § 2 SGB VII aus. Sie stand zwar nicht als Beschäftigte gemäß § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, denn es fehlte an der für eine Beschäftigung erforderlichen Eingliederung in den Betrieb des Ehegatten. Die Klägerin hat eine eigene vollschichtige Tätigkeit mit 35 Wochenstunden an einem anderen Ort ausgeübt. Ihre Tätigkeit für den Ehegatten stellt sich damit als sporadische Hilfstätigkeit dar, bei deren konkreter Ausübung sie sich zwar dem Direktionsrecht ihres Ehegatten unterworfen hat. Nach dem Gesamtzusammenhang der Feststellungen des LSG kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass sie dauerhaft in den Gaststättenbetrieb eingegliedert war. Die Klägerin war allerdings als sog "Wie-Beschäftigte" gemäß § 2 Abs 2 Satz 1 SGB VII versichert, weil sie wie ein nach § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII Versicherter tätig wurde. Die Voraussetzungen einer "Wie-Beschäftigung", dass eine einem fremden Unternehmen dienende, dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Unternehmers entsprechende Tätigkeit von wirtschaftlichem Wert erbracht wird, die ihrer Art nach von Personen verrichtet werden könnte, die in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis stehen, lagen vor. Die Tätigkeit der Klägerin wurde arbeitnehmerähnlich erbracht. Nach den bindenden Feststellungen des LSG diente die unfallbringende Verrichtung der Klägerin einem fremden Unternehmen - dem Gaststättenbetrieb des Ehemanns - und entsprach zugleich dessen Willen. Arbeitnehmerähnlichkeit iS des § 2 Abs 2 SGB VII setzt gerade nicht voraus, dass alle Voraussetzungen eines Beschäftigungsverhältnisses erfüllt sein müssen. Dahinstehen kann dabei, ob diese Tätigkeit typisierend betrachtet üblicherweise von abhängig Beschäftigten erbracht wird, weil dies hier ohnehin der Fall ist. Das Gesamtbild der Tätigkeit muss schließlich in einem größeren zeitlichen Zusammenhang eine beschäftigungsähnliche Tätigkeit ergeben, was im vorliegenden Fall eindeutig zu bejahen ist. Der Ehegatte der Klägerin hätte hier sogar nach den bindenden Feststellungen des LSG eine Beschäftigte an Stelle seiner Ehefrau eingestellt, wenn diese nicht jeweils im Betrieb ausgeholfen hätte. Auch die Weisungsgebundenheit der Klägerin hat das LSG festgestellt, weil sie sich insofern den "klaren Ansagen" ihres Ehegatten unterordnete. Die Klägerin handelte auch nicht als Unternehmerin im eigenen Interesse. Als Unternehmer oder unternehmerähnlich wird eine Tätigkeit verrichtet, wenn die Handlungstendenz nicht auf die Belange eines fremden Unternehmens gerichtet ist, sondern der Verletzte in Wirklichkeit wesentlich allein eigenen Angelegenheiten dienen wollte und es somit an der fremdwirtschaftlichen Zweckbestimmung fehlt. Zwar hat die Revision zutreffend darauf hingewiesen, dass die Interessen der Gaststätte/des Unternehmens sich mittelbar mit den eigenen (ideellen, aber auch wirtschaftlichen) Interessen der Klägerin deckten. Jedoch hat die Revision versäumt, die Sachverhaltsfeststellung des LSG zur Handlungstendenz der Klägerin mit zulässigen und begründeten Gegenrügen (Verstoß gegen Denkgesetze etc) anzugreifen. Gegen das Vorliegen einer arbeitnehmerähnlichen Beschäftigung der Klägerin spricht schließlich auch nicht, dass sie mit dem Inhaber der Gaststätte verheiratet ist. Der Senat hat in ständiger Rechtsprechung das Vorliegen einer Wie-Beschäftigung nach § 2 Abs 2 SGB VII (bzw zuvor nach § 539 Abs 2 RVO) verneint, wenn die konkrete Tätigkeit durch eine Sonderbeziehung des Handelnden zu dem Unternehmer geprägt war. Auch bei einer solchen "Sonderbeziehung" sind allerdings alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen, sodass die konkrete Verrichtung außerhalb oder innerhalb dessen liegen kann, was im Rahmen enger Verwandtschafts- oder Freundschaftsbeziehungen selbstverständlich getan oder erwartet wird. Der Senat teilt die Rechtsansicht des LSG, dass die Mitarbeit der Klägerin in dem Betrieb ihres Ehemanns über das hinausgeht, was im Rahmen der Sonderbeziehung Ehe allgemein von einem Ehepartner erwartet werden kann. Dies folgt zum einen aus dem heute im Familienrecht des BGB normierten Leitbild der Ehe, zum anderen aus dem gemäß Art 6 Abs 1 GG verfassungsrechtlich gebotenen, besonderen Schutz der Ehe und der Familie, der jedenfalls nicht dazu führen darf, dass Ehepartner bei der Beurteilung einer "Wie-Beschäftigung" iS des § 2 Abs 2 SGB VII schlechter behandelt werden als andere Personen, die einander übergebührlich Hilfe und Beistand leisten. Gegen dieses Ergebnis spricht schließlich auch nicht, dass die Tätigkeit der Klägerin sich nicht auf einige kurzfristige Aushilfshandlungen beschränkte, sondern auf Dauer angelegt war. Eine "Obergrenze" der Mitarbeit, die aufgrund ihrer Häufigkeit oder Dauer eine "Wie-Beschäftigung" iS des § 2 Abs 2 SGB VII ausschließt, ist in dem Regelungskonzept des § 2 Abs 2 SGB VII nicht angelegt.